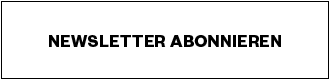Ausgeblendet / Eingeblendet
Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik
Die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik ist noch ungeschrieben. Nun wird sie in der umfangreichen Ausstellung Ausgeblendet / Eingeblendet. Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik (bis 14. Januar 2024) im Jüdischen Museum Frankfurt beleuchtet.
Die Ausstellung handelt von unterschiedlichen und widersprüchlichen Lebenswegen und Karrieren jüdischer Produzenten, Regisseur:innen sowie Schauspieler:innen, die zwischen 1945 und 1989 ihre Erfahrungen in der Filmproduktion machten. Sie zeichnet entlang exemplarischer Filme ihre Geschichten nach, die historische und soziale Kontexte beleuchten. Diese ungeschriebene Filmgeschichte mit ihren bezeichnenden Brüchen eröffnet auch neue Perspektiven auf eines der wichtigsten Medien des 20. Jahrhunderts und seine Bedeutung in der Bundesrepublik. Die Ausstellung basiert auf der Forschung der Filmwissenschaftler:innen Lea Wohl von Haselberg und Johannes Praetorius-Rhein.
Mittwoch 06.09.2023
20:15 Uhr

DAVID
BRD 1979. R: Peter Lilienthal. D: Mario Fischel, Walter Taub, Irena Vrkljan. 126 Min. 35mm
Filmreihe: Ausgeblendet / Eingeblendet
DAVID entstand nach dem autobiographischen Bericht Den Netzen entronnen des Chemikers Joel König und schildert die Geschichte eines jüdischen Jungen zwischen 1933 und 1943, der das Naziregime in Liegnitz und Berlin erlebt und in letzter Minute aus Deutschland entkommen kann. Es ist eine Geschichte immer weiterer Einschränkungen und eines immer weiter verschärften Überlebenskampfs. Das ist ganz aus der Perspektive der Hauptfigur David erzählt, der Film weiß also in keinem Moment mehr als dieser. Er erklärt also auch keine politischen Zusammenhänge, sondern macht die persönliche Sicht eines Betroffenen und seiner Familie prägnant nachvollziehbar.
Online sind für diese Vorstellung derzeit keine Tickets verfügbar.
Bitte wenden Sie sich direkt an die Kasse des DFF.
Mittwoch 13.09.2023
18:00 Uhr

IM LAND MEINER ELTERN
BRD 1981. R: Jeanine Meerapfel. Dokumentarfilm. 87 Min. DCP
Filmreihe: Ausgeblendet / Eingeblendet
IM LAND MEINER ELTERN interviewt und porträtiert eine Reihe jüdischer Einwohner:innen Berlins, darunter Luc Bondy, Eva Ebner und Sarah Haffner. Was bedeutet es, heute – also um 1980 – als jüdischer Mensch in Deutschland zu leben, speziell in der geteilten Stadt Berlin, welche immerhin das Machtzentrum des Nazistaates war? Wie gehen die Betroffenen damit um, und wie geht die Gesellschaft mit ihnen um? Zugleich mit den Interviewten reflektiert die Regisseurin indirekt mit diesem Film auch ihre eigene Situation als Jüdin in Deutschland.
Online sind für diese Vorstellung derzeit keine Tickets verfügbar.
Bitte wenden Sie sich direkt an die Kasse des DFF.
Mittwoch 20.09.2023
17:30 Uhr

EISZEIT
BRD 1975. R: Peter Zadek. D: O. E. Hasse, Ulrich Wildgruber, Hannelore Hoger. 115 Min. 35mm
Einführung: Svetlana Svyatskaya
Filmreihe: Ausgeblendet / Eingeblendet
EISZEIT ist ein Schlüsselfilm über den letzten Lebensabschnitt des Dichters Knut Hamsun, geboren 1859, Literaturnobelpreisträger und während der Besetzung Norwegens durch die Nazis deren Kollaborateur. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung des Landes wird Hamsun zwangsweise in ein Altersheim eingewiesen, und man bereitet einen Prozess gegen ihn vor. Ein junger ehemaliger Widerstandskämpfer sucht ihn dort auf, um ihn zu töten, ist aber im Laufe der Auseinandersetzung immer mehr von ihm fasziniert, sodass fast so etwas wie eine Freundschaft entsteht. EISZEIT entstand nach dem gleichnamigen Theaterstück von Tankred Dorst.
Online sind für diese Vorstellung derzeit keine Tickets verfügbar.
Bitte wenden Sie sich direkt an die Kasse des DFF.
Donnerstag 28.09.2023
18:00 Uhr

DIE VERLIEBTEN
BRD 1987. R: Jeanine Meerapfel. D: Barbara Sukowa, Horst-Günter Marx, Velimir Živojinovic. 95 Min. 35mm
Zu Gast: Jeanine Meerapfel
Filmreihe: Ausgeblendet / Eingeblendet
Eine erfolgreiche Fernsehjournalistin aus Deutschland, Tochter jugoslawischer Gastarbeiter:innen, reist in das Land ihrer Eltern, um dort eine Reportage über jugoslawische Gastarbeiter:innenkinder und deren Integrationsprobleme nach der Rückkehr ihrer Familien zu drehen. Dabei trifft sie einen Deutschen, der die Orte besucht, an denen sein Vater als Soldat im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war, und der auf diese Weise versucht, die Geschichte für sich aufarbeiten. Es ist keine normale Liebesbeziehung, die sich während einiger Tage zwischen den beiden entspinnt, aber auf sensible Weise erörtert der Film dabei die Probleme verschiedener Identitäten.
Online sind für diese Vorstellung derzeit keine Tickets verfügbar.
Bitte wenden Sie sich direkt an die Kasse des DFF.