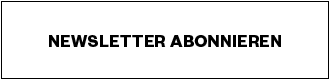Von Marie Brüggemann und Naima Wagner
Was denkt sich einer dabei, WEST SIDE STORY neu zu verfilmen – und dabei alles genau so anzulegen, wie in der 60 Jahre jüngeren Originalverfilmung? Steven Spielberg hat mit seinem Remake Robert Wises und Jeremy Robbins‘ preisgekröntem Werk eine echte Hommage gewidmet: Aufwendige Kostüme und detailreiche Szenenbilder versetzen uns zurück ins Manhattan der 1950er Jahre, wo sich einst Natalie Wood und Richard Beymer als Maria und Tony im Brautmodengeschäft nach Ladenschluss das Ja-Wort gaben – aller Widrigkeiten zum Trotz.
Das Atmosphärische in diesem Film, es zieht einen von Beginn an in den Bann. Das gilt fürs Original genauso wie fürs Remake, denn auch hier: Langsame Kamerafahrten, Ansichten aus der Vogelperspektive auf die Upper West Side New Yorks – eine einzige Baugrube. Großstädtische Totenstille, nur ab und an ein verheißungsvolles Pfeifen – diese Stimmung, in der man gespannt darauf wartet, dass gleich irgendetwas passiert. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, wo eben noch keine Menschenseele zu sehen war, ist plötzlich alles in Bewegung, und wir sind mittendrin in einem wütenden Kampf zwischen – ja, zwischen wem eigentlich? Wer sind all diese, na ja, Teenies?
Spielberg hat sich für eine deutlich jüngere Besetzung entschieden als seine Vorgänger, und wäre das nicht schon irritierend genug, setzt der Gesang des Jets-Anführers Riff sogleich noch eins drauf: Da liegen zwischen Original und Remake nicht nur einige Jahre, sondern ebenso viele Qualitätsstufen, was zum Glück ein Großteil der weiteren singenden Hauptrollen wettzumachen vermag.
Im weiteren Verlauf sind es vor allem die Tanzszenen, die mitreißen, farbenprächtig, rhythmisch, auf den Punkt. Aber um die Rolle der Maria macht sich etwas breit, das zu ignorieren bald unmöglich wird: Grenzenloser Kitsch! Die wunderschöne Rachel Zegler mit ihren großen Rehaugen geht einem schon bald gehörig auf die Nerven, zu schön für ihre Rolle, zu viel Mädchen, zu wenig Charakter. Mir fehlen Natalie Wood und Richard Beymer, Russ Tamblyn in der Rolle des Riff, George Chakiris als Bernardo. Und Rita Moreno fehlen sie auch: Sie gibt dem Ladeninhaber ‚Doc‘ aus der 1961er Version ein weibliches Alter Ego (und ist übrigens auch als ausführende Produzentin beteiligt). Hier dann also doch mal eine eigene, eine neue Idee, aber die Seniorin wirkt allzu verloren in dem neuen Setting, ihre Version des Songs ‚Somewhere‘ eher entmutigend als hoffnungsvoll. Vielleicht tut ihr Auftritt dem Film gerade deshalb nicht gut, weil der direkte Vergleich jetzt unvermeidbar wird: Rita Moreno als Anita ist unantastbar, und nicht mal einer wirklich herausragend performenden Ariana DeBose möchte man zumuten, dieses Erbe anzutreten.
Wenn man etwas imitieren möchte, um es zu würdigen, muss es einfach richtig gut sein – oder anders. Warum hat Spielberg die Story nicht in die Jetztzeit übersetzt? Romeo und Julia, das wissen wir ja alle, funktioniert zu jeder Zeit und in jedem Setting. Gentrifizierung, Rassismus, Bandenkriege, all das sind Themen unserer Zeit. Aber vielleicht hätte das einem betagten Regieprofi zu viel Mut abverlangt.
Doch verdanken wir Spielbergs mehr als ein halbes Jahrhundert andauernden Filmschaffen nicht einige Sensationen? Wer 1975 mit DER WEISSE HAI ein Genre erfand, in den 1980ern mit Indiana Jones eine ikonische Abenteurer-Figur schuf und 1993 in JURASSIC PARK mit bahnbrechenden Spezialeffekten dem Publikum den Atem verschlug – der hätte womöglich auch mit einer Neuinterpretation eines Musical-Klassikers überraschen können.
Zu Beginn war man noch hoffnungsvoll. Die Eröffnungsszene, die die rivalisierenden Gangs erstmals aufeinandertreffen lässt, ist nicht nur grandios choreografiert, sondern auch visuell dynamisch inszeniert: Die Kamera folgt den jungen Männern von der Baustelle auf die Straßen, fliegt über die sich im Wandel befindende Stadt, dreht und wendet sich, scheint regelrecht mitzutanzen. Die Energie der Tanz- und Gesangsnummer überträgt sich auf das Publikum, das sofort mittendrin ist und sich im Geiste bei Spielberg für die Möglichkeit bedankt, die legendären Songs Leonard Bernsteins mit den kongenialen Texten Stephen Sondheims noch einmal im Kino erleben zu dürfen. Im Laufe des Films tritt diese Dynamik bedauerlicherweise ein wenig hinter der aufkommenden Liebesgeschichte und dem sich zuspitzenden Drama zurück.
Bei den Figuren entdeckt man eine willkommene, wenn nicht gar notwendige Aktualisierung im Vergleich zum Original von 1961: Waren die Sharks damals noch größtenteils US-Amerikaner mit dunkler geschminktem Teint, werden sie nun von Darstellern mit puertoricanischen Wurzeln gespielt. Die Entscheidung, die spanischsprachigen Dialogpassagen der pueroricanischen Immigrant:innen nicht zu untertiteln und das Publikum so auch mal bewusst aus Gesprächen auszuschließen, ist vielleicht die mutigste des Films.
An anderer Stelle hätte man sich dann aber doch etwas mehr Mut gewünscht. Die Figur Anybodys, damals schon als ein Mädchen gezeichnet, das sich nicht an Geschlechterrollen halten und Teil der Jungen-Bande sein will, wird nun von der nicht-binären Person Iris Menas gespielt. Ihre Rolle beschränkt sich jedoch weiterhin darauf, von den Jets zurückgewiesen zu werden und im Hintergrund zu agieren. Wäre es nicht toll gewesen, wenn den Gangs ganz selbstverständlich auch Mädchen und nicht-binäre Personen angehört hätten? Die Kritik an (toxischer) Männlichkeit und Machismo und eine stärkere Auflösung von Geschlechterrollen hätte durchaus etwas weiter getrieben werden können – ohne den anderen Themen des Films – Rassismus, ethnische Konflikte, Existenzkampf, Chancenungleichheit, Gentrifizierung und, natürlich, Liebe – etwas von ihrer Bedeutung zu nehmen.
Es sind die Tanz- und Gesangsszenen, die diese großen, zeitlosen Themen verarbeiten, die das Publikum angesichts der möglicherweise verpassten Chancen der Neuverfilmung versöhnlich stimmen. Ein Höhepunkt des Films ist die Performance des Hits „America“, der den Konflikt der puertoricanischen Einwander:innen in den USA auf den Punkt bringt: „Life can be bright in America / If you can fight in America / Life is all right in America / If you’re all-white in America“. Die von Ariana DeBose großartig verkörperte Anita wirbelt durch die Straßen New Yorks und man kann nicht anders, als ich ein weiteres Mal in die Songs und ihr Vermögen, die großen Themen des Lebens in mitreißende Tanznummern zu verwandeln, zu verlieben.
Und so fragt man sich schließlich, ob man wirklich erwartet hat, dass der 1946 geborene US-Amerikaner Spielberg in dieser Neuverfilmung das Rad neu erfindet. Die berechtigte Frage ist: Warum sollte er? Er geht auf Nummer Sicher und verpasst sicherlich auch die ein oder andere Chance einer zeitgemäßen Gestaltung. Doch wer kann es ihm verdenken? Wir sollten diese Neuverfilmung eher als Weihnachtsgeschenk für „West Side Story“-Fans verstehen: Hätten wir sie gebraucht? Nein. Beschert sie uns ein paar schöne Stunden? Auf jeden Fall!