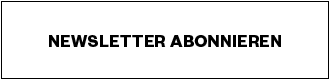Von Frauke Haß
Ein Mann, nicht mehr ganz jung, aber ziemlich athletisch, wird per Hubschrauber mitten in Manhattan auf dem Balkon eines Penthauses abgesetzt. Schnell wird klar, dass es sich um einen Kunstdieb handelt, der es auf die wertvollen Egon Schieles des offensichtlich für längere Zeit in Kasachstan weilenden Wohnungsbesitzers handelt. Der Mann hat nur wenige Minuten Zeit, in denen das aufwändige Sicherheitssystem außer Kraft gesetzt ist. Rasch rafft er die millionenschweren Gemälde zusammen, dabei stets per Funk mit seinen Komplizen verbunden, die ihn antreiben, das allerteuerste der Bilder zu suchen, das nicht am vermuteten Platz hängt. Erfolglos. Das Bild ist in der riesigen Wohnung nicht zu finden und der Mann begibt sich auf den Rückzug.
Doch dann geht etwas schief und die Alarmanlagen heulen ohrenbetäubend laut los. Das System stürzt ab. Alle Türen und Fenster sind geschlossen, die Telefone sind tot, die Klimaanlage dreht durch, aus den Leitungen kommt kein Wasser und die Raumtemperatur steigt und steigt.
Der Mann, Nemo, eindringlich und berührend gespielt von Willem Dafoe, ist gefangen in einer Luxushölle mitten in New York. Seine Komplizen haben ihn fallen gelassen und er ist auf sich allein gestellt. Wie fest er sitzt, begreift er erst nach einigen Tagen, in denen er eingesperrt ohne Nahrung und bei zunehmender Wärme die Wohnung durchstreift und einen Ausweg sucht. Einen Weg, der nach draußen führt. Doch das Penthaus ist ein bewohnbarer Tresor ohne Kommunikationskanal in die Außenwelt. Dafür mit absurden Gimmicks ausgestattet, wie einem Kühlschrank, der jedes Mal, wenn die Tür zu lange aufbleibt, „Macarena“ zu spielen beginnt. Nemos einziger Gefährte ist eine am Flügel verletzte Taube, die auf dem Balkon festsitzt. Er erreicht einen Tiefpunkt, als er bei mehr als 40 Grad Hitze den Kopf verzweifelt ins Tiefkühlfach legt und hemmungslos zu schluchzen beginnt.
Nach und nach fügt er sich seinem Schicksal und sucht dabei gleichzeitig nach Wegen aus dem Luxusknast, während er eine Methode der Wassergewinnung einrichtet und die Einsamkeit bekämpft, in dem er via Überwachungskamera eine – einseitige – virtuelle Bindung zu einer Reinigungskraft knüpft, die außerhalb des Penthauses im Hochhaus putzt. Während er allerlei skurrile Mittel findet, sich zu ernähren und das Gegessene in einem wasserlosen Appartement – auf unappetitliche Weise – wieder loszuwerden, baut er wochenlang an einer gewaltigen Apparatur, die ihn nach draußen führen soll.
Regisseur Vasilis Katsoupis hat seine Robinsonade mitten in eine der dicht besiedeltesten Städte der Welt gelegt und thematisiert dabei parabelhaft die Einsamkeit in der Großstadt, in der die Wohnpaläste der Superreichen zum bombenfesten Gefängnis werden. Das hat er mit einem an alle körperlichen Grenzen gehenden Darsteller und Kameramann Steve Annis so wirkungsvoll und berührend in Szene gesetzt, dass einen die Bilder der bizarren filmischen Versuchsanordnung noch lange Zeit verfolgen.
Die Wirkung dieses philosophischen Film-Experiments ist dabei so überzeugend, dass man ihm gerne auch die ein oder andere logische Ungenauigkeit verzeiht.