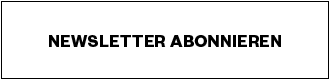Von Naima Wagner
In der Sektion 16+ | Youngsters des diesjährigen LUCAS-Festivals drehte sich alles um starke, junge Frauen, die für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. Während dieser Kampf in BABYTEETH einer auf Leben und Tod der krebskranken Milla ist, kämpft in L’AGNELLO die jugendliche Anita um das Leben ihres krebskranken Vaters. In ÊXTASE ringt die namenlos bleibende Protagonistin mit einer lebensbedrohlichen Essstörung. Die Filme finden dabei denkbar unterschiedliche Wege, die Geschichten der jungen Frauen zu erzählen.
BABYTEETH (Milla Meets Moses, Australien 2019, R: Shannon Murphy) ist zuerst einmal eine Liebesgeschichte: Milla und Moses treffen sich auf dem Bahnsteig. Die 16-Jährige ist fasziniert von dem charmanten Freak mit den blutunterlaufenen Augen, der sie sogleich frech um Geld anpumpt. Immer wieder taucht er daraufhin in ihrem Leben auf. Ob er sich zu Milla oder den Annehmlichkeiten ihres Zuhauses hinzugezogen fühlt, bleibt unklar. Doch Milla ist verliebt und nicht zu bremsen – nicht einmal von ihrer fortgeschrittenen Krebskrankheit. Millas Eltern dagegen suchen verzweifelt nach Wegen, mit der Krankheit und dem nahenden Tod ihrer Tochter umzugehen, während sie zugleich ihre Beziehung zu Moses kritisch beäugen.
Es ist ein bunter Film, der ebenso viel von Familie, Erwachsenwerden und erster Liebe erzählt wie von Sterben und Trauer. Im Kino erleben wir Millas Geschichte als eine Reihe von intensiven Momenten, die, angekündigt von Zwischenüberschriften, das Zeitgefühl außer Kraft setzen. Dass wir dabei nicht so viel von der Krankheit sehen ist kein Manko – was wir sehen sind Momente, die Milla wichtig sind und Momente, die in Erinnerung bleiben. Diese Erzählstruktur hat ihren Ursprung in Rita Kalnejais‘ Theaterstück aus dem Jahr 2012, das als Vorlage diente – auch wenn die australische Regisseurin Shannon Murphy ihre filmische Version der Geschichte davon abgesehen weitestgehend unabhängig von dieser inszenierte.
Der Film ist nicht ohne Schwächen: Mit all seinen Farben und Ideen, seinen schrägen, in ihren Handlungen nicht immer nachvollziehbaren Figuren und seiner allumfassenden „Lebe den Moment“-Haltung wirkt er häufig etwas überladen. Figuren und Situationen werden nicht auserzählt und wirken nicht immer überzeugend. Doch Milla, die selbstbewusst über ihr eigenes Leben mit all seinen großen und kleinen Momenten entscheiden will – das ist etwas, das von diesem Film bleibt.
BABYTEETH startet heute, am 8. Oktober 2020, in den deutschen Kinos.
Auch L‘AGNELLO (The Lamb, Italien 2019, R: Mario Piredda), der seine Deutschlandpremiere bei LUCAS feierte, erzählt von einer Krebskrankheit: Anitas Vater ist schwer krank und wartet auf eine Transplantation. Vielleicht kann Anitas Onkel helfen, doch zwischen den beiden eigensinnigen Männern herrscht seit Jahren Funkstille. Doch die rebellische Anita hat ihren eigenen Kopf und setzt alles daran, den Bruder zum Helfen zu bewegen, während sie zugleich beobachten muss, wie es ihrem Vater immer schlechter geht.
 Der Film von seiner großartigen Protagonistin getragen: Die Laiendarstellerin Nora Stassi beeindruckt als jugendliche Anita, die allen die Stirn bietet. Trotz des rauen Umgangstones und den lauten Auseinandersetzungen ist die tiefe Verbundenheit von Vater und Tochter spürbar, die sich seit dem Tod der Mutter allein durchschlagen. Anita musste, so scheint es, viel zu schnell erwachsen werden. Der Film erzählt seine Geschichte mit mürrischen Figuren und in unsentimentalen Ton – der Protagonistin ist es zu verdanken, dass er uns trotzdem berührt. Anitas innerer Aufruhr spiegelt sich in den Bildern der Landschaft. Die raue Landschaft Sardiniens, für die sich der Film viel Zeit nimmt und die er in faszinierenden Bildern einfängt, ist der zweite Protagonist der Geschichte. Der Wind bläst Anita beständig ins Gesicht, doch sie kämpft sich trotzig voran.
Der Film von seiner großartigen Protagonistin getragen: Die Laiendarstellerin Nora Stassi beeindruckt als jugendliche Anita, die allen die Stirn bietet. Trotz des rauen Umgangstones und den lauten Auseinandersetzungen ist die tiefe Verbundenheit von Vater und Tochter spürbar, die sich seit dem Tod der Mutter allein durchschlagen. Anita musste, so scheint es, viel zu schnell erwachsen werden. Der Film erzählt seine Geschichte mit mürrischen Figuren und in unsentimentalen Ton – der Protagonistin ist es zu verdanken, dass er uns trotzdem berührt. Anitas innerer Aufruhr spiegelt sich in den Bildern der Landschaft. Die raue Landschaft Sardiniens, für die sich der Film viel Zeit nimmt und die er in faszinierenden Bildern einfängt, ist der zweite Protagonist der Geschichte. Der Wind bläst Anita beständig ins Gesicht, doch sie kämpft sich trotzig voran.
Das titelgebende Lamm ist eine Metapher, die sich durch den ganzen Film zieht. Zu Beginn nimmt Anita, die lautstarken Einwände ihres Vaters gelassen ignorierend, das von seiner Mutter verstoßene Lamm auf. Ihr Großvater sagt ihm einen baldigen Tod voraus, doch Anita widerspricht: Schließlich habe auch sie ohne Mutter überlebt. Trotz beständiger Drohungen, es könne bald im Kochtopf landen – Lammgerichte sind typisch für die sardische Küche – zeigt sich das kleine Tier unbeeindruckt und trippelt weiter määh-end durch das Haus. So ist auch nicht überraschend, dass es ihm auch vorbehalten ist, die Geschichte zu beschließen – wie dieses Ende zu interpretieren ist, überlässt der Film uns.
Der LUCAS-Gewinnerfilm ÊXTASE (Ecstasy, Brasilien/USA 2020, R: Moara Passoni), der ebenfalls seine Deutschlandpremiere bei LUCAS feierte, war der mit Abstand experimentellste Film im Wettbewerb 16+ | Youngsters und zugleich der Film, der wohl am stärksten nach der großen Leinwand verlangte. Der Film, ein assoziatives Essay zwischen Dokumentation und Fiktion, ist das Debüt der in New York lebenden, brasilianischen Filmemacherin Moara Passoni.
 Im Mittelpunkt steht eine namenlos bleibende Protagonistin, deren Stimme als Voice-over den 80-minütigen Bilderrausch begleitet. Wir sehen Stationen ihrer Biografie – Balettstunden, Familienfeiern, Universitätsstudien –, die sich jedoch nur am Rande des Blickfeldes abzuspielen scheinen. Im Fokus steht die lebensbedrohliche Essstörung, die zu jeder Zeit Gedanken und Gefühle des Mädchens und später der jungen Frau beherrscht. Wir sehen inszenierte und dokumentarisch wirkende Szenen, historische Nachrichtenbilder und Fotos, begleitet von Gedanken, literarisch-poetischen Verweisen und musikalischen Stimmungen.
Im Mittelpunkt steht eine namenlos bleibende Protagonistin, deren Stimme als Voice-over den 80-minütigen Bilderrausch begleitet. Wir sehen Stationen ihrer Biografie – Balettstunden, Familienfeiern, Universitätsstudien –, die sich jedoch nur am Rande des Blickfeldes abzuspielen scheinen. Im Fokus steht die lebensbedrohliche Essstörung, die zu jeder Zeit Gedanken und Gefühle des Mädchens und später der jungen Frau beherrscht. Wir sehen inszenierte und dokumentarisch wirkende Szenen, historische Nachrichtenbilder und Fotos, begleitet von Gedanken, literarisch-poetischen Verweisen und musikalischen Stimmungen.
Der Film verzichtet darauf, seine Protagonistin auf irgendeine Weise einzuführen. Stattdessen wirft er uns buchstäblich hinein in einen fremden Körper, lässt uns mit fremden Augen sehen – und tut damit auf überwältigende Weise genau das, was (Kino-)Filme tun sollen. Empathie tritt an die Stelle von Sympathie, wenn wir uns in die faszinierenden Bilder fallen lassen, die uns von Leid und von Weiblichkeit erzählen. Es geht um Körperbilder, Schönheitsideale, sozialen Druck und gesellschaftliche Tabus, wobei der Film die Themen am Individuum und zugleich mit universeller Gültigkeit verhandelt.
Der Film verzichtet auch auf erwartbare Bilder: Wir sehen nicht, wie sich die Protagonistin übergibt, wie sie sich im Spiegel betrachtet, wie sie mit ihrer Mutter streitet. Es gibt nur wenige Szenen, in denen sie überhaupt in Interaktion mit anderen Menschen tritt, und gar keine Dialoge. Überwältigend wird so der Eindruck von Einsamkeit im Angesicht dieser schrecklichen Krankheit, der sie ganz allein ausgeliefert ist.
Ein mutiger, außergewöhnlich inszenierter Film, herausfordernd, erschütternd und unbedingt sehenswert.
Hier geht es zum Filmblog-Beitrag zu dem LUCAS-Film NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (Niemals Selten Manchmal Immer, US 2020, R: Eliza Hittman).